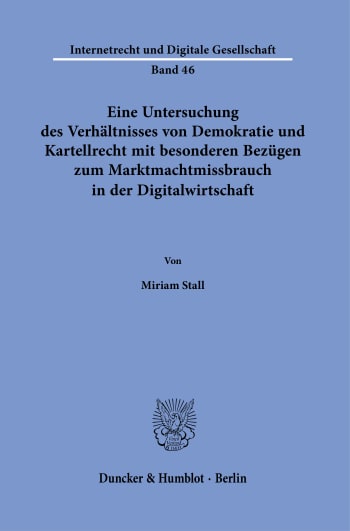Ein Gastbeitrag von Frank Hansel analysiert das drohende Parteiverbotsverfahren gegen die AfD und kritisiert es als eine Strategie, um den demokratischen Wettbewerb zu untergraben. Er argumentiert, dass etablierte Parteien nicht mehr durch Argumente, sondern durch Drohungen wie das Parteiverbot ihre Stellung verteidigen wollen.
Hansel beschreibt die politische Szene als einen Markt mit bestimmten Regeln und Akteuren, bei dem neue Parteien eine wichtige Rolle spielen. Die AfD sei ein Beispiel dafür, dass frische Perspektiven eingeführt werden können und etablierte Parteien gezwungen sind, ihre Programme zu revidieren.
Allerdings begann sich dieser Mechanismus mit dem Aufstieg der AfD umzukehren: Statt sich dem politischen Wettbewerb zu stellen, versuchen die Etablierten, den Konkurrenten durch Diskreditierung und sogar durch das Parteiverbot zu eliminieren. Dies entspricht laut Hansel einem strategischen Marktausschlussverfahren.
Spieltheoretisch gesehen sind die etablierten Parteien in einem nicht-kooperativen Spiel, dessen Gleichgewichte von der AfD gestört werden können. Die Antwort auf diese Störung könnte ein Regeländerungsversuch sein, oft durch Eliminierung des Störfaktors. Ein solcher Versuch würde jedoch das Vertrauen in die Unparteilichkeit und Legitimität des politischen Systems untergraben.
Hansel argumentiert weiterhin, dass ein Parteiverbot nicht nur eine einzelne politische Kraft ausschließen würde, sondern auch negative Externalitäten für das gesamte System erzeugen könnte. Dies führte zu sinkender Wahlbeteiligung und Radikalisierung.
Schlussfolgerung: Das drohende Verbot der AfD ist weniger ein Zeichen von demokratischer Wehrhaftigkeit als eine Reaktion auf den autoritären Reflex, mit dem etablierte Parteien ihre eigene Position schützen möchten. Die Gefahr liegt jedoch nicht in der Existenz einer kritischen Partei, sondern in der Degeneration des politischen Spiels durch Regelveränderung im Sinne eines Scheinwettbewerbs.