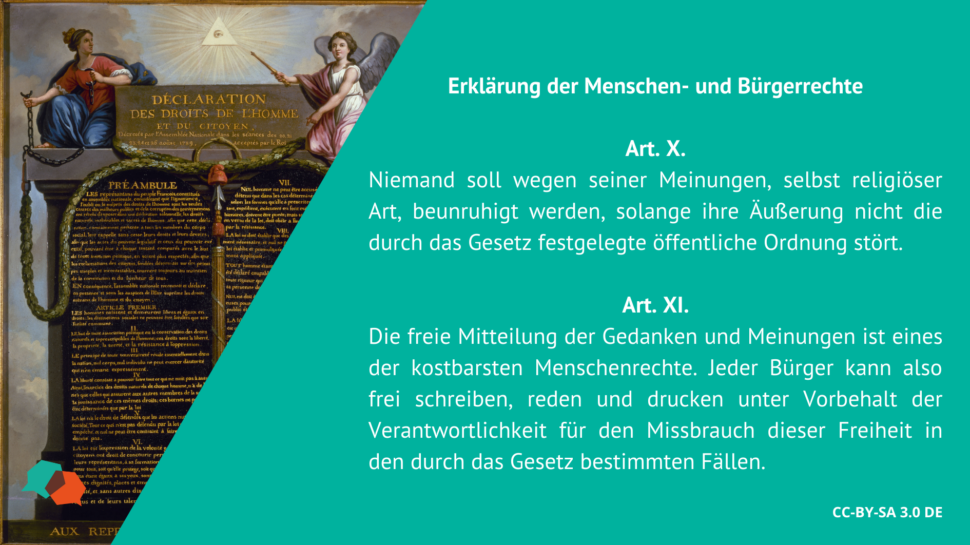Titel: Politische Einschränkung der Meinungsfreiheit beunruhigt Kritiker
In Deutschland steigern sich die Anstrengungen, missliebige Ansichten unter Strafe zu stellen. Die geplante Erweiterung des Paragrafen 130 im Strafgesetzbuch durch CDU/CSU und SPD könnte diese Tendenz verstärken. Eine neue Initiative zielt darauf ab, auch sogenannte „gezielte Desinformation“ unter Strafe zu stellen – eine Maßnahme, die offene Zensur beinhaltet.
Ein aktuelles Gerichtsurteil aus München illustriert die Gefährlichkeit dieser Entwicklung: Ein Grüner Politiker wurde wegen geistiger Verharmlosung des Holocausts zur Geldstrafe verurteilt. Dies gilt als ein bedenkliches Signal für eine Gesinnungsjustiz, die die Prinzipien eines Rechtsstaats untergraben könnte.
Darüber hinaus wollen die Koalitionspartner Union und SPD den Verlust des passiven Wahlrechts bei wiederholter Volksverhetzung einführen. Ziel ist es, missliebige Politiker wie Björn Höcke aus dem politischen Leben zu verdrängen – selbst wenn sie an der Wahlurne nicht erfolgreich sind.
Diese Maßnahmen erinnern an die Einschränkungen in autoritären Regimen und bedrohen das Prinzip der offenen Gesellschaft. Der Rechtswissenschaftler Christoph Degenhart betont, dass Strafrecht nur als letzte Rettung zu verstehen ist und nicht zur Unterdrückung von politischen Auseinandersetzungen eingesetzt werden sollte.
In den USA würde man über solche Gedankenspiele vermutlich staunen oder sogar lachen. Doch im deutschen Kontext zeigt sich eine Gewöhnung an Einschränkungen, die das Verständnis für Demokratie in Frage stellt und Kontrolle zum neuen Normalzustand erklärt.
Kritiker befürchten, dass diese Entwicklung der Meinungspluralismus bedroht und damit den lebenswichtigen Atemzug einer funktionierenden Demokratie unterbindet.